Ulrike Keuper


Soziale Netzwerke und die von ihnen beförderten Selbstinszenierungspraktiken beschäftigen indes nicht nur die Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, sondern werden in den Ausstellungen selbst zum Thema, wie etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Ausstellung „Performing for the Camera“ in der Londoner Tate Modern (18. Februar-12 Juni 2016). Dort war unter anderem die Arbeit „Excellences & Perfections“ der Künstlerin Amalia Ulman zu sehen, die auf Instagram verschiedene weibliche Stereotype verkörperte und diese zu einem pseudo-autobiographischen Plot arrangierte. Doch Soziale Medien wie Facebook, Instagram und Twitter sind weit mehr als nur weitere Kommunikationskanäle oder ein kuratorisches Modethema. Vielmehr, und darum soll es im Folgenden gehen, strukturieren sie als wirkmächtiges Dispositiv Praktiken der Rezeption von Kunst neu. Was also passiert mit dem Kunstmuseum, wenn es sich am Leitbild der sozialen Vernetzung orientiert? Mit dieser Frage sind eine Reihe Konsequenzen verbunden, zu denen sich jedes Ausstellungshaus auf diese oder jene Weise verhalten muss; einige sollen hier schlaglichtartig beleuchtet werden.
Wie sehr man mitunter die Mechanik der Sozialen Medien verinnerlicht hat, lässt sich am Beispiel der Einzelausstellung von Olafur Eliasson studieren, die Ende 2015/Anfang 2016 im Prinz Eugen Winterpalast in Wien zu sehen war. Für „Baroque baroque“, so der Titel der Ausstellung, wurde das strenge Fotografierverbot, das sonst in den Räumlichkeiten verhängt wird, eigens aufgehoben. Nicht nur das, die Besucher wurden sogar dazu ermuntert, während ihres Rundgangs zu fotografieren und ihre Schnappschüsse auf den einschlägigen Plattformen zu veröffentlichen – „share your view“ forderte daher ein Schriftzug am Eingang, ergänzt um den Hashtag #OlafurBaroque. Die Ausstellungsbesucher ließen sich freilich nicht lange bitten: Wie ein flüchtiger Blick auf Instagram zeigt, finden sich im Netz unzählige Nutzerfotos aus der Ausstellung [Abb. 3].
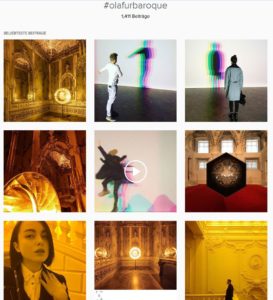
Mit der Aufforderung, Bilder von der Ausstellung zu teilen, rennt man im Fall der Eliasson-Schau sicherlich offene Türen ein. Kaum ein Social Media-affiner Besucher wird der Versuchung widerstehen können, die von den höchst fotogenen Arrangements ausgeht: Farbiges Licht, Spiegel, dazu der Kontrast zwischen barocker Kulisse und zeitgenössischer Formensprache – all dies sind perfekte Requisiten, mit denen sich Besucher vor und mit der Kamera austoben können; der Werkcharakter der Exponate tritt zurück hinter eine bühnenbildhafte Disposition, die dem Inszenierungseifer der Instagrammer Vorschub leistet. Denn längst reicht es nicht mehr, Kunstwerke zum Beleg eines Museumsbesuchs schlicht abzufotografieren. Stattdessen gilt es nun, mit der Kamera über seine Begegnung mit der Kunst zu erzählen, in einem geradezu schöpferischen Gestus seine Beobachtungen zu teilen. Stereotype Aufnahmen vermeidend, sucht man nach unerwarteten Perspektiven und beantwortet die Kunstwerke mit exaltierten Posen und Grimassen (#MusePose). Eine solche Interaktionsfreude entfacht sich längst nicht nur an Arbeiten wie jenen von Eliasson, welche die Beteiligung des Besuchers schließlich dezidiert einfordern, sondern auch in klassischen Gemäldegalerien [Abb. 4].


Mit einer solchen Rückkehr zum Zeichnen vor dem Original wird das Versprechen auf ein intensiveres Kunsterlebnis verbunden.
Mit dem Einzug des Smartphones gerät der Museumsraum zum Schauplatz eines Konflikts – der freilich auch ein Generationenkonflikt ist: Die einen verstehen den Ausstellungsbesuch – zugespitzt formuliert – als Audienz beim Meisterwerk und das Museum als genuinen Ort kunsthistorischer Bildung. Andere betreten den Museumsbau weit weniger ehrfürchtig. Für sie behält die präsentierte Kunst nicht das letzte Wort, sondern ist in eigenen Bildern weiter zu verfeinern und weiterzuerzählen – nicht zuletzt zur Zierde des eigenen Online-Profils. Das Museum ist für sie keine Gegenwelt zur digitalen Umgebung, sondern deren selbstverständliche Fortsetzung.
Man kann diesen Drang, das Kunstwerk als Vorlage für die Inszenierung eines kreativen Selbsts zu nutzen, nun als banale, gar despektierliche Form der Aneignung kritisieren und einwenden, dass diese kaum zu einem tieferen Verständnis der Werke führe. Gleichermaßen ziehen Ausstellungen, die sich einer Weiterverwertung in den Sozialen Medien allzu sehr andienen, Skepsis auf sich und werfen die Frage auf, ob man so nicht ein recht oberflächliches, gar narzisstisch gefärbtes Treiben befördere. Doch so oder so führt kein Weg an der Auseinandersetzung mit dem gewandelten Besuchergebaren im Zeichen der Social Media vorbei. Statt hierin jedoch eine lästige Pflicht zu sehen, die einem der Zeitgeist diktiert, führt ein offensiver Umgang sicherlich weiter. Denn in der von Plattformen wie Instagram und Facebook eingebrachten Dynamik liegt, wie ich im Folgenden argumentieren möchte, eine nicht zu unterschätzende Chance für Kunstmuseen, sich in Zeiten grenzenloser Reproduzierbarkeit zu behaupten.
In seinem berühmten Kunstwerk-Aufsatz beschreibt Walter Benjamin die fotografische Reproduktion als Symptom einer zeittypischen Mentalität; das Publikum strebe danach, sich die „Dinge räumlich und menschlich ‚näherzubringen‘“. Mit der fotografischen Aufnahme versuche es, der Kunstwerke „habhaft zu werden“ (Benjamin 1935/36: 215). Dabei ist die Kunst, so postuliert Benjamin, grundsätzlich unnahbar, „kein Gedicht gilt dem Leser“, so schreibt er an anderer Stelle, „kein Bild dem Beschauer, keine Symphonie der Hörerschaft“ (Benjamin 1921: 9). Mit der „Aura“ formuliert Benjamin ein Bild für die Unnahbarkeit des Kunstwerks: Die Aura sei, so seine berühmte Definition, die „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“ (Benjamin 1935/36: 215). Die fotografische Reproduktion nun missachtet sozusagen dieses Distanzbedürfnis; als Postkarten und Poster holt man Kunstwerke zu sich heran und macht sie sich virtuell verfügbar. Heute kennt die Verfügbarkeit kaum noch Grenzen: Smartphones apportieren fast jedes beliebige Werk direkt in unsere Hände, Dank einfach zu bedienender Bildbearbeitungsprogramme können wir Kunstwerke beliebig verschönern oder verulken, vorgefertigte Blogformate und Plattformen wie tumblr oder Instagram ermuntern uns zum virtuellen Kuratieren. Und wir nehmen Selfies zusammen mit Kunstwerken auf, als wären sie alte Bekannte [Abb. 6].

Bis vor kurzem stellten sich Museen dieser Entwicklung entgegen: Sie schirmten ihre Werke gegen die zahllosen Kompaktkameras der Besucher ab und verkauften dafür hochwertige Postkarten, Poster und Bildbände. In den letzten Jahren jedoch zeichnet sich, was den Umgang mit Reproduktionen betrifft, eine Kehrtwende ab. Dass man, wie in der Wiener Eliasson-Ausstellung, den Dauerknipser demonstrativ willkommen heißt, ist längst keine Ausnahme mehr. Ähnliches gilt für den Zugang zu Bilddatenbanken: Immer mehr Museen digitalisieren gezielt ihre Bestände und stellen hochauflösende Abbildungen zur freien Nutzung ins Netz. Manche Häuser gehen noch offensiver vor: Sie erleichtern nicht nur den Zugang zu hochwertigem Bildmaterial, sondern setzen sogar selbst Anreize, dieses weiter zu verarbeiten. Hier wäre als maßgebliches Projekt das Amsterdamer „Rijksstudio“ zu nennen oder auch der Blog „Tatecollectives“, der von den Tate-Museen geführt wird und sich explizit an junge, technisch versierte Nutzer wendet. Diese werden dazu aufgerufen, Gemälde aus der Sammlung digital zu verfremden, beispielsweise, indem sie aus ihnen animierte GIF-Grafiken generieren [Abb. 7] – mit der Aussicht, in der Tate Britain präsentiert zu werden.
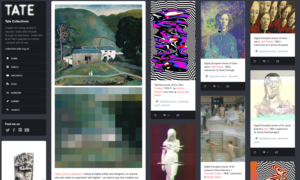
Virtuelle Sammlungen sind folglich nicht nur für Bildung und Forschung ein wahrer Segen. Vielmehr kommen sie dem Bildgebrauch einer digitalen Öffentlichkeit entgegen, für die Kunstreproduktionen weniger von epistemologischem Wert sind, als von gestalterischem. Denn ob im Netz oder vor Ort in den Ausstellungsräumen: Schöpferische Teilhabe an der Kunst gewinnt beim Publikum einen immer höheren Stellenwert gegenüber der schlichten Betrachtung. Freilich hat man schon immer vor dem Original gezeichnet oder Reproduktionen daheim zu Collagen verarbeitet. Durch das Web 2.0 verlieren diese Tätigkeiten jedoch endgültig ihren privaten, innerlichen Charakter und werden Teil einer öffentlichen Selbstinszenierung. Auch scheinbar selbstgenügsame Rezeptionsarbeit gerät zum Bekenntnis zur Kunst und zur demonstrativen Übung in einer Leittugend unserer Zeit, der Kreativität. Symptomatisch für diese Entwicklung scheint mir die eingangs erwähnte Kampagne „Start drawing“: Bezeichnenderweise belässt man es nicht dabei, den Besucher zum genaueren Hinsehen und zur intimen Zwiesprache mit der Kunst anzuregen. Stattdessen folgt sogleich die Aufforderung, die Zeichnung abzufotografieren und mit dem Hashtag #startdrawing zu veröffentlichen. Auf das verbreitete Bedürfnis nach schöpferischer Rezeption reagiert die Kunstvermittlung, wie sich durch weitere Beispielen illustrieren ließe, mit zahlreichen Angeboten – was Wolfgang Ullrich dazu veranlasst, einen fundamentalen Funktionswandel festzustellen: Längst gingen Besucher nicht mehr allein ins Museum, um sich an beispielhafter Kunst zu bilden, sondern „weil sie sich selbst als kreativ erleben wollen“. In diesem Sinne, so spitzt Ullrich zu, fungierten heutige Museen als „Kreativitätsagenturen“ (Ullrich 2016: 94).
Die Verbreitung von Smartphone und Bildbearbeitungssoftware, der Erfolg bilderdominierter sozialer Netzwerke und das Kreativitätsideal begünstigen, so könnte man resümieren, einen Umgang mit Kunst, der ohne Worte auskommt. Mit einem Selfie lässt sich Souveränität vor der Kunst demonstrieren, ohne dass man mit ihren Diskursen und Codes vertraut wäre; man kann seinem Publikum zeigen, dass man die besonderen Reize der präsentierten Werke und der musealen Umgebung zu erkennen, einzufangen und zu beantworten weiß. So entkrampft sich die Rezeptionsarbeit für all jene, die es in Verlegenheit bringt, über Kunstwerke zu sprechen oder gar zu schreiben.
Die Zukunft des Kunstmuseums beschäftigt auch Walter Grasskamp in seinem neuesten Buch. Der Erfolg von Digitalisierungskampagnen wie dem Google Art Project stimmt ihn skeptisch, ob „die Faktur der Kunst im Medienzeitalter tatsächlich ihre spezifische Attraktion“ bleibe. Eine von der Digitalisierung forcierte Verhäuslichung des Kulturkonsums hat schließlich, wie Grasskamp in Erinnerung ruft, schon andere Institutionen wie das Kino in Bedrängnis gebracht (Grasskamp 2016: 95). Tatsächlich wäre es um das Kunstmuseum nicht so gut bestellt, ginge es beim Besuch einer Ausstellung allein darum, die Werke ohne Beeinträchtigung ihrer sinnlichen Qualität zu betrachten. Mittlerweile ist der Repräsentation von Kunstwerken im Netz kaum noch Grenzen gesetzt, tatsächlich lässt sich so manches Werk in der Reproduktion sogar mit mehr Gewinn betrachten, als an seinem Ausstellungsort, wo es von anderen Besuchern belagert wird. Und warum sollte ein Publikum, das kein Problem damit hat, sich im Netz Filme in minderer Qualität anzuschauen, nicht auch mit einem virtuellen Ausstellungsbesuch zufrieden sein? Auch das, was eine Ausstellung erzählerisch und intellektuell zu bieten hat, lässt sich, wenn man ehrlich ist, weitgehend ins Netz verlegen. Würde man also apodiktisch fordern, dass die Auseinandersetzung mit der Kunst ausschließlich der Bildung und dem Erkenntnisgewinn zu dienen hat, dann wäre die unaufhaltsam fortschreitende Digitalisierung wohl tatsächlich eine Bedrohung der Museen.
Indes reißt der Besucherstrom in die Museen nicht ab. Kaum etwas zeugt so eindringlich von der ungebrochenen Anziehungskraft des Originals, wie die Popularität von Artselfies, die Museen dazu bringen, als Ablenkungsmanöver Fotoleinwände aufzustellen. Bezeichnenderweise bleibt der „Selfie Point“ verwaist, während sich vor dem Original-„Kuss“ die Massen tummeln – offenbar muss es also weiterhin das Original mit seiner einmaligen Faktur sein, das Kunstwerk in seinem „Hier und Jetzt“ (Benjamin 1935/36: 212). Neben kulturhistorischer und ästhetischer Bildung bietet eine Kunstausstellung den Besuchern heute eben auch etwas, das sie allein vor Ort haben können: eine fotogene Umgebung, die Inspiration verspricht und in der sich die eigene Lust an der Inszenierung, der bildnerischen Gestaltung und der Assoziationsfähigkeit ausleben lässt. Die Besucher gehen also nicht trotz, sondern gerade wegen des Internets in die Museen, genauer gesagt: wegen Facebook, Instagram und Co. So befremdlich manch einer Aneignungspraktiken finden mag, die der Logik der Sozialen Medien folgen – für das Museum sind sie letztlich eine gute Nachricht.
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Fünfte Fassung, 1935/36, in: Lindner, Burkhardt (Hrsg.): Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe. Frankfurt 2012, Bd. 16, S. 207255.
Benjamin, Walter: Die Aufgabe des Übersetzers, 1921, in: Wolf Tiedemann / Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.): Gesammelte Schriften. Frankfurt a.M. 1972-1989, Bd. 4, S. 9-21.
Grasskamp, Walter: Das Kunstmuseum. Eine erfolgreiche Fehlkonstruktion. München 2016
Jones, Jonathan: New York museums are banning selfie sticks? What a heroic idea. The Guardian, 6. 2. 2015 https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/feb/06/selfie-sticks-banned-new-york-museums-moma
Kemp, Wolfgang (Hrsg.): Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. Ostfildern 1991
Ullrich, Wolfgang: Der kreative Mensch. Streit um eine Idee. Salzburg 2016
Ulrike Keuper
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Akademie der bildenden Künste München
Jahrgang 1986. 2005-2011 Studium der Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe sowie der Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2011-2015 Promotionsstudium an der HfG; Dissertation zum Thema „Übersetzung als Metapher. Zur Rezeptionsgeschichte druckgrafischer und fotografischer Kunstreproduktion“. 2011-2013 nebenberufliche Tätigkeit in einer PR-Agentur für IT-Firmen. Seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Akademie der Bildenden Künste München.


